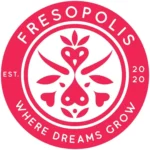Bedeutung und Konsequenzen
Mikroplastik – winzige Kunststoffpartikel kleiner als fünf Millimeter – ist längst nicht mehr nur ein Problem der Meere. Auch unsere Böden sind zunehmend mit Mikroplastik belastet. Die Folgen reichen von Veränderungen der Bodenstruktur bis hin zu gesundheitlichen Risiken für Mensch und Tier, da Mikroplastik über die Nahrungskette sogar unser Gehirn erreichen kann.
Wie gelangt Mikroplastik in den Boden?
Die Eintragspfade von Mikroplastik in Böden sind vielfältig:
Landwirtschaft: Der Einsatz von Mulchfolien und Plastikabdeckungen im Obst-, Gemüse- und Spargelanbau trägt erheblich zur Belastung bei. Auch Klärschlamm und Kompost, die als Dünger verwendet werden, enthalten große Mengen an Mikroplastik aus Haushaltsabwasser, Kosmetika und dem Abrieb synthetischer Textilien.
Reifenabrieb und Müll: Mikroplastik gelangt durch Reifenabrieb, achtlos entsorgten Müll und industrielle Emissionen in die Umwelt und damit in den Boden.
Fragmentierung: Größere Plastikstücke werden im Boden durch physikalische, chemische und biologische Prozesse zu immer kleineren Partikeln zerkleinert, bis sie als Mikro- und Nanoplastik vorliegen.
Auswirkungen von Mikroplastik auf den Boden
Mikroplastik verändert die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Bodens:
Bodenstruktur: Die Partikel beeinflussen die Größe und Form der Bodenaggregate, was zu einer veränderten Porenstruktur, Luft- und Wasserhaushalt sowie einer verringerten Bodendichte führen kann.
Nährstoffkreisläufe: Mikroplastik kann die Nährstoffverfügbarkeit, Enzymaktivitäten und die Zusammensetzung der mikrobiellen Gemeinschaften im Boden beeinflussen.
Bodenorganismen: Regenwürmer, Springschwänze und andere Bodenlebewesen nehmen Mikroplastik auf, was ihre Vitalität und Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen kann. Auch Pflanzen können kleinste Partikel über die Wurzeln aufnehmen und in ihre oberen Pflanzenteile

Aufnahme von Mikroplastik durch Pflanzen und Tiere
Pflanzen: Studien zeigen, dass Nutzpflanzen wie Reis, Mais und Weizen Mikroplastik über die Wurzeln aufnehmen können. Die Partikel werden in Blättern und anderen Pflanzenteilen eingelagert, was die Photosyntheseleistung und damit die Ernteerträge verringert.
Tiere: Bodenorganismen wie Regenwürmer oder Schnecken nehmen Mikroplastik auf und tragen so zur weiteren Verteilung im Boden bei. Über die Nahrungskette gelangt Mikroplastik in Insekten, Fische und schließlich auch in den menschlichen Körper.
Mikroplastik in der Nahrungskette und im menschlichen Körper
Nahrungskette: Mikroplastik ist in vielen Lebensmitteln nachweisbar, etwa in Meeresfrüchten, Fisch, Meersalz und sogar in pflanzlichen Produkten. Menschen nehmen Mikroplastik vor allem über die Nahrung, aber auch über Trinkwasser und die Atemluft auf.
Aufnahme im Körper: Im Verdauungstrakt können Mikroplastikpartikel von den Darmzellen aufgenommen werden. Kleinste Partikel (Nanoplastik) gelangen in den Blutkreislauf und können sich in verschiedenen Organen anreichern, darunter Leber, Niere und sogar das Gehirn.
Mikroplastik im Gehirn: Wie gelangen die Partikel dorthin?
Blut-Hirn-Schranke: Neuere Studien zeigen, dass Mikroplastikpartikel, die kleiner als ein Mikrometer sind, die Blut-Hirn-Schranke überwinden können. Dies geschieht, wenn sich körpereigene Moleküle wie Cholesterin an die Partikel anlagern und so die Passage durch Membranbarrieren erleichtern.
Neurologische Effekte: In Tierversuchen wurden Mikroplastikpartikel bereits zwei Stunden nach Aufnahme im Gehirn nachgewiesen. Dort können sie die Durchblutung stören, zu Entzündungen führen und neurologische Störungen verursachen, wie etwa Verhaltensänderungen und kognitive Einschränkungen.
Fazit
Mikroplastik im Boden ist ein wachsendes Umweltproblem mit weitreichenden Konsequenzen. Die Partikel beeinflussen die Bodenstruktur, schädigen Pflanzen und Bodenorganismen und gelangen über die Nahrungskette bis in den menschlichen Körper. Besonders besorgniserregend ist die Fähigkeit von Mikroplastik, die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden und potenziell neurologische Schäden zu verursachen. Die Forschung steht zwar noch am Anfang, doch die bisherigen Erkenntnisse unterstreichen die Dringlichkeit, den Eintrag von Plastik in die Umwelt zu reduzieren und nachhaltige Alternativen zu fördern.
Autor: Francesco del Orbe